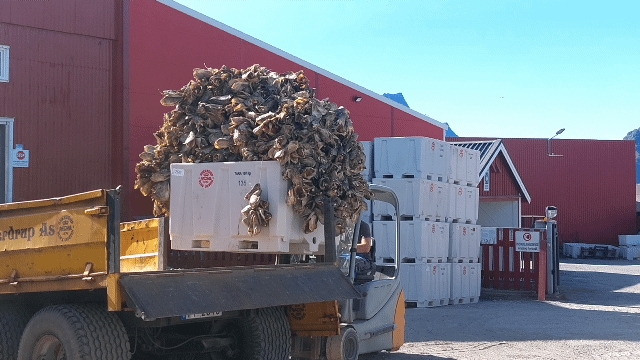Dienstag, 4. Juli
Nein, das stimmt nicht: 5 Inseln mit so vielen Bergen, dass man sie nicht zählen kann. Das sind die Lofoten, norwegisch ausgesprochen Luhfottn.
Reiseführer überbieten sich meist mit noch mehr Superlativen als ohnehin: Atemberaubend, imposant, grandios, unvergesslich, magisch, einzigartig, majestätisch, geradezu episch sei die „Karibik des Nordens“. Dazu gibt es dann sehr schöne Bilder mit Polarlichtern und Schnee und rotglühenden Sonnenuntergängen, aufgenommen von unerreichbaren Berggipfeln aus mit sündhaft teuren Fotoausrüstungen. Nichts, was Otto Normalurlauber so vor Ort begegnet. Da macht die Sonne mittags alles platt, es stehen Autos und Reisebusse (oder Speedboote) im Blickfeld und ständig läuft einem ein anderer Tourist durch’s Panorama.
Ich will nicht mosern, nur relativieren! Ich glaube, es wird ein Hype aufgebaut und am End traut sich keiner, eine andere Meinung zu äußern oder – weit schlimmer noch – zu haben. Wir machen da erst mal nicht mit und schauen uns die Lofoten selber an! Und dann schau’n wir mal, welche Adjektive dabei rauskommen!
Heute Morgen habe ich jedenfalls die grandiose (!) Idee, den HoGo noch einen Tag auf dem CP stehen zu lassen und das sightseeing mit den Fahrrädern anzugehen 👍. Volker zuckt überhaupt nicht und willigt sofort ein.
Unser erstes Tagesziel ist das Örtchen Å (gesprochen O wie in Och) am Ende der E10, also am äußersten Zipfel von Moskenesøya, der Südinsel. Seine Hauptattraktion ist das Ortsschild. Wenn es denn nicht wieder völlig zugebappt ist oder gar geklaut.

Auf der teils engen E10 trägt man als Radler besser eine Warnweste.

Das Fischerdorf liegt malerisch auf einer Halbinsel und besteht „downtown“ zum größten Teil aus einem Museum. Oder es ist ein Museum – wie immer man das nennen mag.
Seit der Tourismus zu Kaiser Wilhelms II. Zeiten begonnen hat, steht Nostalgie in Norwegen hoch im Kurs. Und erst recht auf den Lofoten. Hier ging es mit der Fertigstellung der E10 1963 allmählich los und mehr und mehr wurden aus Fischerhütten urige Unterkünfte (Rorbuer), aus Lagerhallen werden Fischrestaurants und aus Kutterkapitänen Guides für Whale-Watching-Touren. Ganze Ortschaften wurden zu Museumsdörfern, und auch hier in Å wirkt das ganze Gebiet um den Hafen wie ein Heimatmuseum (das es natürlich auch explizit hier gibt). Passend dazu die „Gammelbutikk“ (Antiquitätenladen) und die Museumsbäckerei von 1850, in deren Holzofen Kaneelsnurre – Zimtschnecken – gebacken werden. Natürlich die besten Norwegens, obwohl sie mir anderswo schon besser geschmeckt haben.





In Å müssen wir umkehren, denn hier endet die Straße. Wer weiter südlich will, muss wandern.

Da das Torrfisk-Museum in Å leider geschlossen war (Personal krank), freuen wir uns umso mehr auf das Telegrafenmuseum in Sørvågen und eine Abwechslung von der Überdosis Landschaft und Idylle, die wir hier ständig auf uns einprasselt. Das Museum ist in Norwegens erster Telegrafenstation untergebracht, die 1861 ihren Betrieb aufnahm.




Die Fernmeldetechnikanlagen revolutionierten die Lofotenfischerei und erhöhten die Erträge: Über die 170 Kilometer lange kabelgebundene Telegrafenverbindung (teils unter Wasser) waren 9 Fischerdörfer untereinander in Kontakt und konnten Informationen über Wetter, Fanggründe, Kundenanfragen etc. austauschen. Ursprünglich war der Telegraf nur während der Fischereisaison zwischen Januar und April in Betrieb, wurde aber schon 1868 an das Telegrafennetz auf dem Festland angeschlossen und lief dann bald das ganze Jahr über. Die neuen Kommunikationsmöglichkeiten sorgten dafür, dass die Erträge der Fischerei auf den Lofoten deutlich stiegen. 1906 ging die erste drahtlose Verbindung in Betrieb, 2 Jahre später die Schiffstelegrafenverbindung, 1928 Radiotelefone. Bis zur Automatisierung war das Telegrafenamt, später das Telefonamt, rund um die Uhr in Betrieb. Auch das norwegische Fräulein vom Amt stöpselte hier die Telefonverbindungen!
Stolz zeigt uns Kjell Alf Øye die Telekommunikationsgeräte aus 2 Jahrhunderten (ein Nokia Handy ist auch dabei) und lässt für uns sogar die Telefone klingeln. Wir merken: Sein Herzblut hängt an diesem Museum. Ist auch kein Wunder, sein Großvater und sein Vater waren Leiter der Telegrafenstation, im Obergeschoss wohnte die Familie. Kjell hat in diesem Haus gelebt, bis die Station 1977 geschlossen wurde. Unter den Hunderten von Fotos an den Wänden hängt auch ein Kinderbild von ihm. Klar, dass Kjell seine Brötchen später bei der norwegischen Telefongesellschaft verdient hat! Er macht ein Foto von uns für seine Sammlung und wir kriegen eines für unsere! Ein toller Besuch, der richtig zu Herzen ging 🧡.


Wir verabschieden uns herzlich und radeln weiter über die E10 Richtung Reine. Um die Tunnel führt zum Glück eine Umgehung, da wären wir nur sehr ungern durch, trotz Warnweste.
Kurz vor Reine kommen wir am Trailhead zu DER Wanderung vorbei: Der Weg hinauf zum Hausberg, dem 448 m hohen Reinebringen. Eigentlich ist es keine Wanderung, sondern Treppensteigen! Auch hier haben nepalesische Sherpa die knapp 2.000 Stufen angelegt. Für mich klar zu viele und viel zu steil! Aber mit Sicherheit ein geiler Blick von da oben. Bei besserer Vorbereitung wäre Volker das Teil sicher angegangen.



Nun sind wir aber gespannt auf das schönste Dorf der Lofoten, den wundervollsten Blick und das beste Fotomotiv ever und überhaupt! Dafür muss man nämlich nicht auf den Reinebringen, das gibt es vom Parkplatz vor der Brücke! Und so sieht das dann aus:


Vom Ort selbst sind wir aber enttäuscht: Hoffentlich ist das nicht das schönste Fischerdorf der Lofoten! Die Rorbuer (Fischerhütten) am Kai sind ganz nett, aber die gibt es wie Sand am Meer.

Ansonsten ist das ein ganz normaler Ort mit Geschäften, Muckibude, Tourismusangeboten (Kajak, Angeln, Speedboot …). Mitten drin ist die große Fischfabrik. Immer wenn die Tür aufgeht, kommt ein Schwall raus und in Reine riecht es wie auf dem Fischmarkt.
Und sie geht auf, denn hier wird gearbeitet! Davon können wir uns überzeugen, als wir im Gammelbua nebenan ein Bierchen trinken. Und wir kriegen auch bald raus, was die da in die Fabrik gabelstaplern:
Fischköpfe! Getrocknete Kabeljauköpfe. Die werden abgetrennt, wenn der Kabeljau (oder Dorsch) zu Stockfisch verarbeitet wird, separat aufgehängt und – man glaubt es kaum – nach Afrika verkauft. Die Einkäufer aus Nigeria kommen jedes Jahr im Frühling hierher, inspizieren die Ware und ordern riesige Mengen. Die kommen in die dortige Fischsuppe. Unglaublich, aber wahr!
Und noch ein Sidefact: Den Dorschköppen fehlt die Zunge! Die gilt als Delikatesse und wird vorher rausgeschnitten. Das machen traditionell Kinder ab 6 Jahren – auch heute noch – und bessern damit ihr Taschengeld auf. Wer Dorschzunge mal probieren möchte, hier ein Rezept. Ich lass das mal lieber sein.
Auf unserem abschließenden Weg zum Leuchtturm (der ist übrigens ebenfalls keine Schönheit) finden wir sie dann: An den großen Holzgestellen die allüberall hier rumstehen (die meisten aber leer) hängen sie ab, die Dorschhäupter!

Die meisten sind wie gesagt schon in Nigeria und den Rest karren die Norweger hier in die Fischfabriken. Was da wohl draus wird – ich will’s gar nicht wissen 🤢.